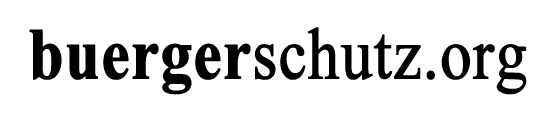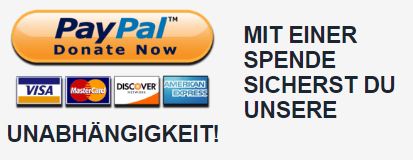PRESSEAUSSENDUNG
Bürgerschutzverein fordert vollständige Aufklärung über Rechtsanwaltskosten der Stadt Klagenfurt – Transparenzanfrage nach K-AOG eingebracht
Klagenfurt, am 25.04.2025
Der Bürgerschutzverein hat im Rahmen seiner statutarischen Verpflichtung zur Wahrung des öffentlichen Interesses und zum Schutz von Gemeinwohl und Steuermitteln eine formelle Transparenzanfrage gemäß dem Kärntner Auskunftspflicht- und Transparenzgesetz (K-AOG) an die Stadt Klagenfurt eingebracht. Anlass ist die dokumentierte Zahlung in der Höhe von insgesamt 50.000 Euro an einen Rechtsanwalt, deren Grundlagen, Entscheidungswege und sachliche Rechtfertigung bislang nicht nachvollziehbar offengelegt wurden.
Anfrage umfasst konkrete Prüfungspunkte
- Wofür genau wurden diese Rechtsanwaltskosten verwendet?
- Auf welcher Entscheidungsgrundlage wurde die Beauftragung vorgenommen?
- Welche Person oder welches Gremium hat den Auftrag initiiert bzw. genehmigt?
- Gab es eine Vergabe nach objektiven Kriterien oder eine öffentliche Ausschreibung?
- Wurde geprüft, ob gleichwertige Leistungen durch andere Kanzleien zu günstigeren Konditionen hätten erbracht werden können?
- Lag ein konkreter, nachvollziehbarer Anlass zur Beauftragung externer Rechtsvertretung in dieser Höhe vor?
Die Beantwortung dieser Fragen ist essenziell, da es sich bei der Mittelverwendung um öffentliche Gelder handelt, die nach den Prinzipien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit gemäß Art. 126b B-VG sowie der Gemeindeordnung (K-AGO) einzusetzen sind.
Rechtliche Fundierung
- Auskunftsrecht des Bürgerschutzvereins: Laut § 2 Abs. 1 K-ISG und Art. 20 Abs. 4 B-VG steht jedem – auch juristischen Personen wie Vereinen – ein subjektives Recht auf Auskunft zu. (VwGH 24.09.1990, 90/12/0057)
- Vergaberecht: Nach dem BVergG 2018 sind auch Gemeinden verpflichtet, Rechtsanwaltsleistungen auszuschreiben – sofern keine gesetzliche Ausnahme vorliegt. (VwGH 26.02.2015, Ra 2014/04/0101)
- Organhaftung: Nach § 1 Abs. 1 OrgHG haften Gemeinderatsmitglieder für schuldhaft und rechtswidrig verursachte Schäden. (OGH 30.01.1997, 2 Ob 182/01f)
- Haushaltsrecht: Die Missachtung der Haushaltsgrundsätze kann zur Auflösung des Gemeinderats führen. (VwGH 17.05.1995, 93/01/0670; VfGH VfSlg. 7568/1975)
Stadt Klagenfurt zur Offenlegung verpflichtet
Die Stadt ist gemäß §§ 3–4 K-AOG verpflichtet, innerhalb von acht Wochen sachlich, vollständig und nachvollziehbar zu antworten. Eine Verweigerung der Auskunft stellt eine rechtswidrige Verletzung der Informationspflicht dar.
Bürgerschutzverein kündigt weitere rechtliche Schritte an
Im Falle einer unzureichenden Reaktion behalten wir uns vor, verwaltungsrechtliche und strafrechtliche Verfahren einzuleiten sowie die persönliche Haftung von Entscheidungsträgern nach dem Organhaftpflichtgesetz prüfen zu lassen.
Warum wir Ihre Unterstützung brauchen
Der Bürgerschutzverein ist unabhängig, parteifrei und ausschließlich spendenfinanziert. Unsere Arbeit lebt von der Unterstützung durch engagierte Bürgerinnen und Bürger. Viele Menschen verfügen über Wissen, das zur Aufklärung beitragen kann – wir nehmen solche Hinweise anonym und diskret entgegen. Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, damit wir weiterhin juristisch fundiert und unabhängig für Transparenz und Gerechtigkeit eintreten können.
www.buergerschutz.org – Ihr Verein für Gerechtigkeit und Aufklärung.
Kontakt für Rückfragen:
Bürgerschutzverein Österreich
Ihre Unterstützung schützt die Wahrheit!
Investigative Recherchen kosten Zeit, Geld und Mut. Helfen Sie uns, unabhängig zu bleiben und weiterhin Missstände aufzudecken. Vielen Dank!
Banküberweisung IBAN: AT37 3932 0000 0005 3124
Schicken Sie uns Ihre Infos an: aufdecker@buergerschutz.org
1. Auskunftspflicht nach dem K-AOG (Kärntner Auskunftspflicht- und Transparenzgesetz)
In Kärnten haben alle Auskunftswerber – also „Jedermann“, einschließlich Vereine und juristische Personen – ein rechtlich verbrieftes Recht auf Auskunft durch Gemeindeorganeris.bka.gv.at. Dieses Auskunftsrecht wird durch Art. 20 Abs. 4 B‑VG in Verbindung mit dem K-AOG gewährleistet und als subjektives Recht ausgestaltetwko.at. So hat der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) klargestellt, dass Behörden Auskunftsbegehren unabhängig von der Rechtsform des Antragstellers zu behandeln haben, soweit keine Verschwiegenheitspflicht entgegensteht (vgl. VwGH 24.09.1990, Zl. 90/12/0057). Gemeindeverwaltungen dürfen Auskunftsbegehren von Vereinen also nicht mit dem Argument zurückweisen, der Auskunftsanspruch stehe nur natürlichen Personen zu. Insbesondere bestätigt § 2 Abs. 1 K-ISG (Informations- und Statistikgesetz Kärnten) ausdrücklich: „Jedermann hat das Recht, Auskünfte […] zu verlangen.“ris.bka.gv.at.
Beleg: § 2 Abs. 1 K-ISG („Jedermann hat das Recht, Auskünfte […] zu verlangen.“)ris.bka.gv.at; Art. 20 Abs. 4 B-VG iVm. Auskunftspflichtgesetzen (subjektives Auskunftsrecht)wko.at. (Beispiel-Entscheidung: VwGH 24.09.1990, 90/12/0057 – Auskunftspflicht der Gemeinde gegenüber jur. Person).*
2. Vergaberecht (BVergG 2018) – Direktvergabe von Rechtsanwaltsleistungen durch Gemeinden
Auch Gemeinden sind als öffentliche Auftraggeber an die vergaberechtlichen Vorgaben des Bundesvergabegesetzes 2018 (BVergG 2018) gebunden. Rechtsanwaltsleistungen unterliegen – von engen Ausnahmen abgesehen – grundsätzlich der Ausschreibungspflicht nach dem BVergG. Eine Direktvergabe ohne Vergabeverfahren ist nur im gesetzlichen Rahmen zulässig, etwa unterhalb bestimmter Wertgrenzen oder bei ausdrücklich ausgenommenen Leistungen. Insbesondere die vertretungsweisen Rechtsdienste in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren sind vom Vergaberegime ausgenommen und können direkt beauftragt werden, wohingegen allgemeine Rechtsberatungs- oder Gutachterleistungen als Dienstleistungsaufträge regelmäßig dem Vergabegesetz unterfallenwko.at. Der VwGH hat betont, dass ein Verstoß gegen diese Vorgaben – z.B. eine unzulässige freihändige Vergabe oberhalb der Schwellenwerte – den Grundsatz der Gleichbehandlung der Bieter verletzt und rechtswidrig ist. So wurde etwa in einem Erkenntnis des VwGH die direkte Beauftragung einer Kanzlei durch eine Gemeinde ohne Ausschreibung aufgehoben, da kein Ausnahmetatbestand vorlag (VwGH 26.02.2015, Ra 2014/04/0101). Gemeinden dürfen Rechtsanwaltsverträge also nur dann direkt vergeben, wenn entweder der Auftragswert im erlaubten Bereich liegt oder die Leistung nach BVergG ausdrücklich vom Vergaberegime ausgenommen ist. Andernfalls ist ein Vergabeverfahren (etwa im Wege eines angemessenen Auswahl-/Vergabeverfahrens) erforderlich, widrigenfalls die Vergabe rechtswidrig und anfechtbar ist.
Beleg: Grundsatz der allgemeinen Auskunfts- und Teilnahmefreiheit im Vergaberechtwko.at; vgl. sinngemäß VwGH 26.02.2015, Ra 2014/04/0101 (unzulässige Direktvergabe einer Dienstleistung über dem Schwellenwert).
3. Organhaftung von Gemeinderäten (OrgHG) bei pflichtwidrigem Verhalten mit Schaden für die Gemeinde
Gemeindevertreter haften persönlich für Schäden, die sie der Gemeinde durch rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten in Ausübung ihres Amtes unmittelbar zufügen. Diese Organhaftung ist im Organhaftpflichtgesetz (OrgHG) geregelt. Nach § 1 Abs. 1 OrgHG haftet ein Organwalter nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts für den Vermögensschaden, den er als Organ der Gebietskörperschaft durch schuldhaftes und rechtswidriges Verhalten in Vollziehung der Gesetze unmittelbar verursachtris.bka.gv.at. In der Praxis bedeutet das: Gemeinderatsmitglieder, die einen offensichtlich gesetzwidrigen Beschluss fassen, der der Gemeinde finanziellen Schaden zufügt, können zum Ersatz verpflichtet werden. Die Rechtsprechung betont insbesondere, dass bei evident zweckwidriger Verwendung von Gemeindemitteln – also wenn Gelder offenkundig am gesetzlichen Zweck vorbei eingesetzt werden – eine persönliche Haftung der verantwortlichen Mandatare eintreten kann. So hat der Oberste Gerichtshof (OGH) etwa entschieden, dass ein Bürgermeister persönlich haften musste, als er Gemeindegelder vorsätzlich für einen vom Gemeinderat nicht gedeckten Zweck ausgab (OGH 30.01.1997, 2 Ob 182/01f). In Fällen grober Pflichtverletzung (etwa bewusster Gesetzeswidrigkeit oder krasser Missachtung von Weisungen) ist die Haftung nach dem OrgHG ausdrücklich vorgesehen. Allerdings kennt das OrgHG auch Mäßigungs- und Freizeichnungsmöglichkeiten – z.B. kann das Gericht den Schadenersatz bei bloß grob fahrlässigem Handeln aus Billigkeitsgründen mäßigengemeindebund.at. Entscheidend ist jedenfalls, dass Gemeinderäte nicht sanktionslos rechtswidrige Beschlüsse zulasten der Gemeindekasse fassen dürfen: Bei Schaden haften sie im Zweifel persönlich mit ihrem Privatvermögen nach Maßgabe des OrgHG.
Beleg: § 1 Abs. 1 OrgHG (Haftung des Organwalters für schuldhaft und rechtswidrig verursachten Vermögensschaden der Gemeinde)ris.bka.gv.at; vgl. OGH 30.01.1997, 2 Ob 182/01f (Haftung eines Bürgermeisters für wissentlich rechtswidrige Geldverwendung).
4. Haushaltsrecht: Art. 126b B-VG und Kärntner Gemeindeordnung (K-AGO) – Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit
Die öffentliche Haushaltsführung der Gemeinden steht unter dem verfassungsrechtlichen Gebot der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit (Art. 126b B-VG). Diese Grundsätze bedeuten, dass Budgetmittel effizient und zweckgerichtet einzusetzen sind. Verstöße dagegen können aufsichtsbehördliche Maßnahmen des Landes nach sich ziehen. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) und Verwaltungsgerichtshof (VwGH) haben hierzu leitende Entscheidungen getroffen: Overspending oder offenkundig unwirtschaftliches Handeln einer Gemeinde können einen Eingriff der Aufsichtsbehörde rechtfertigen. So hielt der VwGH im Jahr 1995 fest, dass bereits die begründete Annahme, eine Gemeinde sei nicht mehr imstande, ihre Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen, die Auflösung des Gemeinderats durch die Landesaufsicht rechtfertigen kann (VwGH 17.05.1995, 93/01/0670gemeindebund.at). Der VfGH fordert jedoch eine strenge Verhältnismäßigkeit solcher Eingriffe: Selbst bei Missachtung der Haushaltsgrundsätze darf die Gemeindeaufsicht nur als ultima ratio einschneidende Maßnahmen wie die Gemeinderatsauflösung ergreifengemeindebund.at. In VfSlg. 7568/1975 etwa erkannte der VfGH, dass die grobe Verletzung der Finanzgebarung (z.B. anhaltende Gesetz- oder Budgetwidrigkeit) eine Auflösung des Gemeinderats rechtfertigen kann, jedoch nur nach vorheriger Ausschöpfung gelinderer Mittelgemeindebund.at. Auch die Kärntner Gemeindeordnung (K-AGO) verpflichtet die Gemeindeorgane zur gesetzmäßigen und sparsamen Gebarung – z.B. durch die Pflicht zu ausgeglichenen Voranschlägen und zur zweckgebundenen Mittelverwendung. In der Praxis bedeuten diese Bestimmungen: Der Gemeinderat muss das Budget so gestalten und vollziehen, dass kein Geld für sachfremde oder unwirtschaftliche Zwecke verschwendet wird. Bei evidenten Verstößen (etwa wenn Ausgaben beschlossen würden, die gegen geltendes Recht oder den Haushaltsplan verstoßen) könnten das Land oder – im Extremfall – der VfGH einschreiten. Insgesamt untermauern die Gerichtsentscheidungen, dass die Einhaltung der Grundsätze von Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit rechtlich erzwingbar ist und Missachtungen Folgen für die Gemeindeorgane haben können.
Beleg: VwGH 17.05.1995, 93/01/0670 (Gemeinderatsauflösung wegen Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Haushaltsführung)gemeindebund.at; VfGH VfSlg. 7568/1975 (aufsichtsrechtliche Konsequenzen nur als ultima ratio bei grober Missachtung der Haushaltsgrundsätze)gemeindebund.at.
Ihre Unterstützung schützt die Wahrheit!
Investigative Recherchen kosten Zeit, Geld und Mut. Helfen Sie uns, unabhängig zu bleiben und weiterhin Missstände aufzudecken. Vielen Dank!
Banküberweisung IBAN: AT37 3932 0000 0005 3124
Schicken Sie uns Ihre Infos an: aufdecker@buergerschutz.org